Die Schweiz, ein goldener Käfig?
Zum AnfangNiklaus Mueller
BusinesspläneVorankommen in einem Land, das am Aufholen istSusan Misicka (Text), Daniele Mattioli (Bilder)
Niklaus Mueller Shanghai studies
Niklaus Mueller Shanghai studies


Für Niklaus Mueller ist China der Ort schlechthin: Er lebt zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren dort. Wie viele Schweizer und Schweizerinnen seiner Generation ist der 32 Jahre alte Mueller darauf erpicht, die Welt zu erkunden und diese Erfahrungen zu seinem Vorteil zu nutzen.
Weniger typisch ist, dass er gegen den Strom schwimmt.
"Viele meiner Freunde wollten nach Westen, aber ich wollte zurück in den Osten. China fasziniert mich. Und obschon ich bereits mehr als zwei Jahre dort gelebt hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich mein Verständnis des Landes und seines Platzes in der globalen Wirtschaft noch vertiefen könnte", erklärt Mueller gegenüber swissinfo.ch.
Tadellos gekleidet und ausgerüstet mit seinen eigenen Notizen kommt er zum Interview. Mueller scheint ein Mann zu sein, der Dinge sorgfältig in Betracht zieht und sich entsprechend vorbereitet. Seine ersten Eindrücke von China gehen auf ein Praktikum im Jahr 2011 bei der internationalen Anwaltskanzlei CMS zurück. 2012 musste er für seine Anwaltsprüfung zurück nach Zürich, doch China liess ihn nicht mehr los.
"Ich war überzeugt, dass ich einen Weg finden musste, nach China zurückzukehren", sagt Mueller. Zurück in Schanghai bot ihm CMS die Chance, mit einem Vollzeitpensum seine Karriere anzuschieben – was er dann auch zwei Jahre lang tat.
Da er nicht für immer bei der Firma bleiben wollte, in der er als Praktikant angefangen hatte, wechselte Mueller die Stelle und ging zur Credit Suisse in Zürich. Doch China lockte weiterhin – und so schrieb er sich 2015 für das MBA-Programm an der China Europe Business School (CEIBS) ein.
"Ich interessiere mich sehr für Unternehmertum und Innovation und angesichts der aktuellen Entwicklung in China finde ich, dass dies einer der aufregendsten Orte ist, an dem man sein kann", erklärt Mueller, der ursprünglich aus Bern kommt.
Seine Begeisterung erstreckt sich auch auf die Kultur, die Geschichte und die Sprachen Chinas, insbesondere Mandarin.
"Es scheint, als würde hinter jedem Schriftzeichen eine Geschichte stecken. Und wenn man versucht, diese Geschichten zu verstehen, hilft das einem dabei, sich an die Zeichen zu erinnern", erklärt Mueller. Bisher bestand er vier von sechs Prüfungsebenen und bereitet sich nun auf die fünfte Prüfung vor – bei der er 2500 Schriftzeichen kennen muss.

Foto GalerieMBA-Student in Schanghai
(Bilder: Daniele Mattioli)
Goldenes Sicherheitsnetz
Goldenes Sicherheitsnetz


Goldenes Sicherheitsnetz
Mueller hat viel Ehrgeiz und das half ihm auch, die tatsächliche oder vermeintliche Vorstellung des "goldenen Käfigs" Schweiz zu überwinden.
"Ich kann verstehen, dass Leute sich in der Schweiz irgendwie etwas eingeschränkt fühlen. Sie sagen, es sei schwierig, Veränderungen durchzuziehen, weil die Verhaltensnormen derart klar seien. Es könnte schwierig sein, diese Muster zu durchbrechen", sagt Mueller.
Er glaubt jedoch, dass Schweizer und Schweizerinnen dankbar sein sollten für die politische und wirtschaftliche Stabilität des Landes.
"Das hilft uns. Wir haben den Luxus, uns ins Ausland wagen zu können. Und wenn es nicht klappt, sind wir in der komfortablen Lage, immer in die Schweiz zurückkehren zu können. Ich bin ziemlich sicher, dass ich innerhalb einiger Monate eine Stelle finden würde, falls ich nach Hause zurückkehren würde", sagt Mueller. "Das nimmt viel vom Druck weg, wenn man in ein anderes Land zieht."
In der Tat wäre ein "goldenes Sicherheitsnetz" vielleicht der bessere Ausdruck für etwas, von dem nicht alle Menschen profitieren können. Mueller führt das Beispiel einer spanischen Kollegin an, die in China habe bleiben müssen, weil es schwierig war, in Spanien eine Stelle zu finden.
Vergleich China-Schweiz
China selbst erlebt eine Periode des wachsenden Wohlstands und besserer Beziehungen zu anderen Staaten.
"Man findet chinesische Unternehmen in ganz Europa und im Rest der Welt. Zudem denke ich, dass sich mit dem Freihandelsabkommen, das China und die Schweiz 2014 unterzeichneten, interessante Möglichkeiten eröffnen könnten", erklärt Mueller.
Und während die Schweiz in Sachen Innovation zwar oft einen hohen Rang einnimmt, lobt Mueller auch den unternehmerischen Geist Chinas.
"Innovation ist eine heikle Sache. In den Nachrichten liest man oft, dass China ein Nachahmer sei. Sieht man aber, was geschieht, hat China in gewissen Industrien wie E-Handel und im Bereich Finanztechnologie eine Führungsposition übernommen", sagt Mueller. Und schaue man sich Technologiefirmen in den USA an, gebe es oft Entsprechendes in China. Als Beispiele führt er Alibabas Taobao, Tencents WeChat und Didi Kuaidi an, Chinas Antwort auf eBay, WhatsApp und Uber.
Er ist auch beeindruckt von den Technologie-Lösungen für kleine Unternehmen, wie etwa Telefon-Apps zum Bezahlen, die in China praktisch alle nutzten. Dabei unterstreicht er, dass es solche Apps in China seit Jahren gebe, während sie in der Schweiz noch relativ neu seien. Dies hat wahrscheinlich mit dem Optimismus und der Aufgeschlossenheit zu tun, die das China charakterisieren, das Mueller erlebt.
"Die Menschen in China können mit Unsicherheit und Mehrdeutigkeit gut umgehen, während wir Schweizer gerne alle Details kennen möchten. Wir mögen es nicht, wenn es zu viele offene Fragen gibt", sagt Mueller. Er erinnert sich daran, wie er dies bei Vertragsverhandlungen bei der Anwaltskanzlei beobachten konnte, für die er gearbeitet hatte. "Da konnte man durchaus das Aufeinanderprallen von Kulturen sehen. Aus meiner Sicht hilft es, wenn man etwas lockerer wird."
Kompromisse
Auf die Frage, was er an China nicht möge, antwortet Mueller mit Vorsicht. Es ist, als wolle er nicht riskieren, das Land, in dem er lebt, zu beleidigen, ein Land, in dem Nachrichten zensuriert werden.
"Es gibt Massen von Menschen – ein Gedränge auf den Strassen und ein überfülltes Metro-System – aber damit komme ich klar, denn man kann es nicht ändern", sagt er, und legt dabei diese Art von Selbstzensur und Diplomatie an den Tag, die ihm sicher dabei helfen wird, geschäftlich weiter zu kommen.
Wo er aber Raum für Verbesserungen sieht, ist die Umweltpolitik. Jeden Morgen konsultiert er eine App mit Informationen zur Luftverschmutzung.
"Die Luftqualität ist viel zu häufig schlecht. Manchmal kann man kaum 100 Meter weit sehen. Im Winter ist es schlimmer als im Sommer. Und es gibt Tage, an denen man wegen der schrecklichen Qualität der Luft keinen körperlichen Aktivitäten im Freien nachgehen kann. Und Tage, an denen man sich selbst einschränkt und einfach drinnen bleiben will", beklagt sich Mueller. Die Natur der Schweiz ist etwas, das er in China vermisst.
Es sei alles etwas paradox, findet Mueller. Angesichts der Belastung der Umwelt, sei klar, dass das riesige Wirtschaftswachstum einen hohen Preis habe. "Aber es gibt auch positive Signale, etwa die bedeutenden Investitionen, die China in die Entwicklung erneuerbarer Energien steckt, und die Unterstützung für das UNO-Klimaabkommen, das 2015 in Paris verabschiedet wurde."
Ein anderes Thema, das Mueller Sorgen macht, ist der Tierschutz. Während er einerseits begrüsst, dass alle essbaren Teile von Tieren genutzt werden, man denke zum Beispiel an Schweinsohrensalat oder an gebratene Hühnerfüsse, ist ihm nicht wohl, wenn er daran denkt, wie Tiere in China behandelt werden.
Besonders was die Tierhaltung und das Schlachten angehe, gebe es Dinge, die nicht passieren dürften. Mueller verweist unter anderem auf Tiere, die auf engstem Raum zusammengepfercht in Käfigen gehalten werden.
Was er hingegen liebt, sind chinesische Teigtaschen, sagt er und prahlt damit, dass er heute sogar selber ganz gute Teigtaschen kochen könne.
Ist die Zukunft ... rosig?
Weil Schanghai eine sehr kosmopolitische Stadt ist, erlebte Mueller keinen extremen Kulturschock, auch wenn er Schwierigkeiten hatte, Schuhe der Grösse 45 zu finden. Er erinnert sich zudem daran, beim Einkaufen einer Feuchtigkeitslotion einmal auf etwas Unerwartetes gestossen zu sein.
"Ich wusste, dass chinesischen Frauen viel daran liegt, möglichst helle, weisse Haut zu haben, es gibt daher viele aufhellende Cremes. Aber es gibt auch eine unglaubliche Vielfalt solcher Produkte für Männer. Das hatte mir niemand gesagt, aber es ist offenbar für viele etwas Wichtiges", sagt Mueller und lacht; er selber hat blaue Augen und ist von Natur aus hellhäutig.
Spezielle Kosmetikprodukte hin oder her, die Zukunft sieht für Mueller und die Menschen in China rosig aus.
"Sie sind optimistisch. Sie wissen, dass dies ihre Zeit ist, und sie eine wirtschaftlich rosige Zukunft vor sich haben", sagt ein begeisterter Mueller, der seine Energie aus dem schnellen Wachstum und dem Tempo zieht – was vor allem für Schanghai gilt. "Es ist unglaublich, hier zu sein und dies alles aus erster Hand mit zu erleben."
Und wie fügt er sich als Schweizer in diese Umgebung ein?
"Wer in China leben will, muss bereit sein, in die Kultur hier einzutauchen. Daher ist es wichtig, dass man versucht, die chinesische Zivilisation und Geschichte zu verstehen, und auch versucht, die Sprache zu lernen."
Er räumt aber ein, dass Schanghai eine sehr internationale Stadt sei – und ein ziemlicher Gegensatz zu gewissen Orten, die er in China auf dem Land besucht habe.
Schanghai sei ein bisschen eine Welt für sich. "Für mich ist dieser Ort nicht typisch für China. Die Stadt ist recht kosmopolitisch und ein kultureller Schmelztiegel."
Sein MBA-Programm will Mueller 2017 abschliessen. Was danach kommt, ist offen. Er ist neugierig, mobil und hat Fähigkeiten, die ihn irgendwo auf der Welt hinführen könnten.

Blaettler-Schwestern
Suaheli-SchwesternDer Elefant im ZimmerAnand Chandrasekhar (Text), Georgina Goodwin (Bilder)
Blaettler Schwestern Afrikanische Kunst
Blaettler Schwestern Afrikanische Kunst


"Ich konnte in der Schweiz nicht mehr leben. Ich fühlte mich zu überwacht", sagt die 52-jährige Daniela Blaettler aus Lugano, die heute auf der kenianischen Insel Lamu an der Nordküste des Landes lebt.
Ihr Vater stammte aus Airolo im Norden des Kantons Tessin, ihre Mutter aus Pontresina im Kanton Graubünden. Als sie 19 Jahre alt war, machte sie sich auf in die weite Welt. Sie verliess ihre liebevolle Familie und das Heim im italienischsprachigen Schweizer Landesteil in Richtung des sonnigen St. Tropez. Auch wenn sie aus einer Familie mit grossem Zusammenhalt stammte und zwei Schwestern und einen Bruder hatte, war der Drang, ihr Heimatland zu verlassen, zu stark.
"Die Schweiz ist sehr schön, aber ich brauchte etwas mehr als einfach nur Schönheit", sagt sie. "Ich suchte nach Herausforderungen, weil das Leben für einen jungen Menschen in diesem Land zu einfach war."
Doch auch das glamouröse St. Tropez konnte Daniela nicht zufriedenstellen. Nach sieben Jahren an der französischen Riviera, während denen sie im Geschäft einer Freundin arbeitete und Häuser verkaufte, begannen ihr langsam die Füsse zu jucken. Es war ein Termin beim Coiffeur, der ihr Leben verändern sollte: Während sie im Magazin Paris Match blätterte, sah sie ein Bild von Menschen, die auf afrikanischen Elefanten ritten.
"Ich hatte immer davon geträumt, in meinem Garten einen Elefanten statt einen Hund zu haben", erzählt sie. "Als ich dieses Bild sah, hat das meinen Traum neu angefacht. Ich war St. Tropez überdrüssig und bereit für eine Veränderung."
Nach einigen Recherchen fand sie heraus, dass die Fotografie in einem Elefanten-Rehabilitationszentrum in Botswana entstanden war. Umgehend schrieb sie dem Besitzer einen Brief, der nach einem Jahr antwortete und sie einlud, im Zentrum mit Elefanten arbeiten zu kommen. So begann ein weiteres Abenteuer auf ihrer Wanderschaft.
"Wir drehten Filme, machten Werbung und führten Elefanten-Safaris durch", sagt sie. "Im Projekt ging es darum, problematische Elefanten aus Zoos in aller Welt zu retten und sie schliesslich in Afrika in die Wildnis zu entlassen."
Die grosse Schwester schaute zu
Ein paar Jahre später träumte Danielas grosse Schwester Marina Oliver Blaettler ebenfalls davon, die Schweiz zu verlassen. Doch anders als bei ihrer Schwester ging es dabei nicht um Teenager-Fantasien auf der Suche nach neuen Horizonten. Sie war damals 34, arbeitete für eine Softwarefirma und lebte ein komfortables Leben.
"Ich wachte eines Morgens auf und entschied, dass es nicht das ist, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte", sagt die heute 56-Jährige. "Ich fühlte mich gefangen, die Schweiz war mir zu klein."
Marina wollte die Welt bereisen. Zuerst wollte sie in Afrika Station machen und ihre Schwester Daniela besuchen, bevor sie weiterreisen würde. Es sollte anders kommen. "Wir sind sehr ähnlich, meine Schwester und ich", kommentiert Daniela. "Wir haben das gleiche Herz."
Am Anfang reagierte die Familie geschockt, dass gleich zwei Schwestern nach Afrika ausgewandert sind. Doch sie hätten sie immer unterstützt. "Meine Eltern gaben mir nie Geld, sie sagten mir aber, dass ich immer ihre Liebe hätte und ein Zimmer in ihrem Haus, sollte ich je zurückkommen wollen. Das gab mir die Kraft, zu gehen", erzählt Daniela.
"Meine Mutter hätte vermutlich dasselbe gemacht, wäre sie aus unserer Generation. Mein Vater war sehr schweizerisch, aber er verstand unser Bedürfnis, die Welt zu entdecken", sagt Marina.
Die Geschwister der beiden Schwestern waren weniger abenteuerlustig. Ihr älterer Bruder zog nach Spanien, die älteste Schwester aber blieb in Lugano, wo sie recht zufrieden ist.
"Sie lebt 200 Meter vom Haus meiner Mutter entfernt in Lugano", sagt Daniela. "Sie hat einen Ehemann, drei Kinder und einen Hund. Nicht jeder muss seine Heimat verlassen."

FotogalerieDas Leben an der Küste Kenias geniessen
(Bilder: Georgina Goodwin)
Afrikanische Realität
Afrikanische Realität


Während Daniela mit den Elefanten beschäftigt war, wurde Marina angeboten, das Zentrum zu leiten. Es war ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte. "Ich ging zurück in die Schweiz, verkaufte das Haus, das Auto und alles andere und ging zurück nach Botswana", sagt sie.
Die Arbeit im Elefantenzentrum nahm beide Schwestern in Beschlag. Doch ihr gemeinsames Abenteuer in Botswana sollte nicht ewig dauern: Auf einer Erkundungsreise nach Kairo, bei der sie den Strassentransport zweier Elefanten planten, war Marina betroffen von der Armut, die sie unterwegs sahen.
"Die vielen Menschen am Strassenrand gaben mir das Gefühl, dass ich es nicht rechtfertigen kann, so viel Geld für Elefanten zu sammeln, während es auf diesem Kontinent ganz andere Probleme gab", erzählt sie.
Auch Daniela war zwei Jahre später ernüchtert, als sie zusehen musste, wie ein geliebter Elefant in Ketten gelegt wurde. "Ich sagte ihnen, ich würde nur zurückkommen, wenn sie meinen Elefanten in die Wildnis freilassen würden. Zwei Jahre später kam ich zurück, und er wurde freigelassen. Ich folgte ihm drei Monate lang, um sicherzugehen, dass er es schaffen würde. Dann ging ich wieder nach Kenia und fing ein neues Leben an."
Neubeginn
Daniela verliebte sich in einen englischen Meeresbiologen, den sie in Nairobi getroffen hatte. Doch die Beziehung sollte nicht von Dauer sein. "Er ist ein wundervoller Mann. Ich habe immer noch ein gebrochenes Herz", erzählt sie.
Um sich vom emotionalen Trauma zu erholen, nahm sie einen Auftrag an, Fischer auf der kenianischen Insel Lamu zu fotografieren. Sie war verzaubert von diesem Ort und seiner Fischergemeinschaft. "Lamu ist der schönste Ort auf der Welt. Es gibt keine Autos, keine Discos oder Kasinos. Es ist noch unberührt", sagt sie. "Hier bin ich immer verliebt."
Doch die lokalen Fischer waren nicht auf Rosen gebettet. Die Konkurrenz von Fischtrawlern und das Meer, das während der Regenzeit gefährlich war, machten ihnen das Leben schwer.
Einer der Fischer, Ali Lamu, fragte sie nach einem Job. Sie überlegte sich, wie sie helfen könnte – und hatte eine kreative Idee: "Mich faszinierte das Material, das sie für die Segel ihrer Boote benutzten", sagt Daniela. "Ich malte ein grosses Herz auf Segeltuchstoff, fügte den Satz 'Love Again Whatever Forever' dazu und rahmte das Ganze."
Sie fragte eine Freundin, ob sie da Werk in ihrem Laden ausstellen könne. Weniger als eine Stunde später war es bereits verkauft, für über 190 Franken. Mit der Hilfe der Fischer machte Daniela ein paar mehr davon, und bald schon war sie erfolgreich genug, um mit solcher Kunst und Taschen aus rezyklierten Segeln der Fischerboote ein Geschäft zu machen.
Sie nannte die Marke Alilamu, nach dem Fischer. Heute sind bei der Firma 30 Personen Vollzeit angestellt, darunter auch Ali Lamu, der Direktor ist. "Ali Lamu ist meine Stütze, mein Freund, Bruder und grösster Unterstützer", sagt Daniela.
Auch Lamus Leben hat sich verändert, seit er Daniela nach einem Job gefragt hatte. "Ich konnte meiner Familie ein kleines Haus bauen und kann meine Kinder zur Schule schicken", erzählt er. "Als ich ein Fischer war, mietete ich ein Zimmer und musste immer kämpfen, um die Miete bezahlen zu können."

FotogalerieBei den tansanischen Massai Erfüllung finden
(Bilder: Georgina Goodwin)
Tansanische Kunst
Tansanische Kunst


Wie ihre Schwester fand auch Marina nach dem Elefantenzentrum eine neue Heimat. Sie fuhr für eine Ferienreise nach Tansania – und wollte nie mehr weg von dort.
"An diesem Land gefällt mir seine Vielfältigkeit mit Bergen, Savannen und Wäldern. Botswana war zwar auch schön, aber völlig flach." Sie verliebte sich in den Afrikakenner Paul Oliver und heiratete ihn. Nun leitete sie sein erfolgreiches Safari-Camp in der Nähe von Arusha im Norden des Landes.
Doch mit dem Herzen war sie nicht ganz dabei in diesem Job. Eine Chance ergab sich, als eine Freundin, die in Mailand eine Nichtregierungs-Organisation betrieb, ihr ein spannendes Angebot machte.
"Sie fragte mich, ob ich interessiert wäre, für ein Projekt zu arbeiten, das Massaifrauen durch den Verkauf ihres Glasperlen-Schmucks ein Einkommen bieten wollte. Ich nahm den Job an, unter der Bedingung, dass das Projekt eines Tages auf eigenen Füssen stehen müsse."
Zwei Jahre später wurde aus dem Projekt die unabhängige Firma Tanzaina Maasai Women Art, für die 200 Massaifrauen arbeiten. Die Frauen legen zehn Prozent der Einnahmen für Instandhaltungsarbeiten wie etwa die Reparatur einer Hütte zur Seite.
"Etwa 99 Prozent der Frauen sind ungebildet und leben in Armut", sagt Marina. "Ich kann keine radikalen Veränderungen in ihrem harten Leben bewirken, doch das Geld aus den Verkäufen des Glasperlen-Schmucks verbessert zumindest ihre Zuversicht und ihr Selbstwertgefühl."
Ihr Leben ist wirklich hart. Die Massaifrauen müssen Holz sammeln und Wasser holen, um für die Familie kochen zu können, und sie müssen das Vieh betreuen. Bei Entscheiden in der Gemeinschaft werden ihre Ansichten in der Regel nicht beachtet, und oft werden sie auch körperlich misshandelt.
Marina brauchte ein ganzes Jahr, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Sie hofft, dass die Massaifrauen eines Tages das Geschäft selber führen können und sie austeigen und ihr nächstes Projekt in Angriff nehmen kann: Ein Reitzentrum für behinderte Kinder.
"Marina hat einen starken Charakter", sagt die Massai Margaret Gabriel, die bis April 2016 für die Verkäufe im Ladengeschäft verantwortlich war. "Sie liebt das, was sie macht und ist sehr aufmunternd. Die Frauen haben grosse Freude, wenn neue Bestellungen hereinkommen."
Schweiz? Zu viele Regeln
An die Schweiz denken die beiden Schwestern kaum, auch wenn sie ihr Heimatland einmal im Jahr besuchen. "Wenn ich in der Schweiz bin, fühle ich mich wie in einem Ferien-Resort. Alles ist so sauber und organisiert", sagt Daniela.
In ihren Ferien isst sie gerne Schweizer Küche, macht Wanderungen in den Bergen und geht beim nationalen Detailhändler Migros einkaufen. "Ich fühle mich mehr Suaheli als schweizerisch", sagt Daniela. "Ich schätze es zwar, wenn Leute pünktlich sind, aber falls nicht, ist das keine grosse Sache."
Daniela hat sich in die Gemeinschaft von Lamu integriert und vier lokale Kinder zwischen drei und 18 Jahren adoptiert. Im Dorf nennt man sie Khalila. "Lamu ist sehr schön und friedlich, was gut für die Gesundheit, das Herz und die Seele ist", sagt sie. "Ich wache auf, laufe zum Strand, um den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang zu sehen. Doch gleichzeitig kann ich auch den Zug von Mombasa nach Nairobi nehmen und in eine Stadt gehen, wenn ich Geschäfte machen will."
Auch wenn sie die Schweizer Schokolade vermisse, könne sie nicht mehr in der Schweiz leben, sagt Daniela. Sie fühle sich dort zu stark kontrolliert. "Es hat so viele Hinweistafeln, was man tun darf und was nicht. Auf Lamu sind wir sehr frei, trotz all der Gefahren rundherum."
Eine allgegenwärtige Bedrohung ist die somalische Al-Shabaab-Miliz, die in der Region um Lamu verschiedene Angriffe durchgeführt hat. Somalia ist nicht weit. "Auf der Insel gibt es keine Al-Shabaab-Angriffe, aber man sieht Sicherheitskräfte auf Strassen, an Stränden und in grossen Hotels, seit vor ein paar Monaten eine Drohung ausgesprochen wurde", erzählt ihr Geschäftspartner und Freund Ali Lamu.
Lamu macht sich auch Sorgen über die Verantwortung, die Daniela schultert, etwa für die vier Kinder, die sie betreut. "Sie hat ein grosses Herz. Doch manchmal ist sie allein und braucht jemanden, der oder die ihr unter die Schulter greift. Wie etwa damals, als ihre Adoptivtochter krank war", sagt er.
Hüttenleben und grosse Weiten
Auch das Leben ihrer Schwester Marina ist Welten weg von einer typischen Schweizer Existenz. Sie lebt in einer mongolischen Jurte auf der Farm von Freunden – zusammen mit einem Pferd, einem Esel und zwei Hunden.
"Die Schweiz ist einengend. Ich liebe die Weiten hier: die Berge, Wälder und Savannen", sagt sie. Selten folgt sie einem genauen Stundenplan, weil ihre Arbeit – und das tansanische Leben generell – oft Überraschungen mit sich bringt. Doch wenn es etwas weniger chaotisch zu und her geht, nimmt sie sich gerne mal etwas Zeit für kurze Unternehmungen.
"Ich beginne meinen Tag mit einem Ritt und gehe dann zum Büro und Ladengeschäft in Arusha. Am Abend gehe ich heim und mache einen langen Spaziergang mit meinen Hunden, schaue mir den Sonnenuntergang an, und manchmal gehe ich mit Freunden etwas trinken oder essen", erzählt sie.
Im Gegensatz zu Botswana gibt es in Tansania keine gefährlichen Wildtiere wie Löwen oder Leoparden – nur kleinere Raubtiere wie Hyänen oder Schakale. Marina kann sich frei bewegen. In der Gegend leben auch Massai, deren Hütten, Boma genannt, die umliegende Landschaft prägen. An Wochenenden fährt sie mit dem Fahrrad zu den Massai-Dörfern und redet mit den Leuten über Möglichkeiten, ihr Einkommen aufzubessern.
Doch nicht alles ist Postkarten-Afrika. "Viele Leute beneiden mich, weil ich in Afrika lebe. Aber es kann auch schwierig sein", sagt sie. "Dinge gehen kaputt, und es gibt viel Bürokratie und Korruption."
Zudem hat sie sich von ihrem Ehemann getrennt und ist ausser einigen Freundinnen ziemlich auf sich allein gestellt. Trotzdem glaubt sie nicht, dass sie gegenwärtig in die Schweiz zurückkehren könnte.
"Die Schweiz ist eine kleine Insel, und das zeigt sich darin, wie die Leute denken. Es hört an der Grenze auf", sagt sie. Sie vermisst den Schnee und das Skifahren, wie auch den Schweizer Sinn für Organisation. "Es ist sehr schwierig, unter Drittwelt-Bedingungen Produkte für die erste Welt herzustellen. Manchmal kann der langsame Rhythmus der Tansanier frustrierend sein."
Fragile Zukunft?
Ihre ehemalige Arbeitskollegin Margaret Gabriel sorgt sich um Marina. Sie arbeite und mache zu viel. Gabriel macht sich auch Sorgen um die Zukunft des Unternehmens, in das Marina so viel gesteckt hat.
"Sie muss an die nächste Generation denken, weil einige der Frauen alt werden und nicht mehr gut genug sehen, um die Glasperlen-Stickereien zu machen. Sie muss Projekte mit jungen Frauen anfangen, um die Zukunft der Firma zu sichern", sagt Gabriel.
Trotz der hohen Arbeitsbelastung und der Verantwortung für 200 Massaifrauen bereut Marina nichts. "Ich lebe meinen Traum. Ich habe alles, was ich brauche, auch wenn ich nicht viel Geld habe. Ich habe meinen Frieden, das war mein Lebensziel."
Ihre Schwester Daniela hat noch einen Tipp für Schweizerinnen und Schweizer, die davon träumen, eines Tages das Land zu verlassen. "Meine Freunde bezeichnen mich als mutig, aber ich verstehe das nicht. Es ist mutiger, für den Rest des Lebens in der Schweiz zu bleiben. Folge Deinem Herzen, mach Dir keine Sorgen über Geld, alles ist möglich, wenn Du ein offenes Herz hast."

Silvia Brugger
Wilde EntschlossenheitEin Briefwechsel mit der ersten Schweizer Frau, die am Iditarod in Alaska teilgenommen hatPhilipp Meier (Text), Trent Grasse (Bilder)
Silvia Brugger Alaska Abenteuer
Silvia Brugger Alaska Abenteuer


Hier ist ein kurzer Bericht über mich. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas zusammenstelle und ich bin gar nicht sicher, wo ich beginnen soll.
So hat Silvia Brugger einen langen, briefähnlichen Text zu ihrer Auswanderungs-Geschichte angefangen. Der Kontakt zu ihr kam zustande, wie es heutzutage üblich ist: Online – und in diesem Fall via Facebook.
New Content Item
Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.
Es ist ein grosses Glück, dass sich Silvia auf meinen Aufruf auf Facebook meldete – eine ehemalige Schulkollegin von der Verkehrsschule Luzern hat sie auf meinen Post aufmerksam gemacht. Ganz selbstverständlich machte sie nämlich das, was heute "User Generated Content" genannt wird: Sie verfasste ihre Geschichte gleich selber. Ich habe mir einzig erlaubt, zwischendurch und am Schluss noch etwas genauer nachzufragen.
1974 bin ich geboren und aufgewachsen in Cham/ZG.
Ich habe 4 Geschwister – Max ist mein Zwillingsbruder und die anderen drei sind 4 und 8 Jahre älter (meine Schwestern sind auch Zwillinge).
Schon als Kind und Teenager bin ich viel in Europa rumgereist. Meine Grosseltern wohnten in Norddeutschland und unsere Familie hatte einige Islandpferde, mit denen meine Schwestern und ich praktisch jedes Jahr an Turniere ins Ausland gereist sind.
Nach Beendigung der Sekundarschule besuchte ich die Verkehrsschule in Luzern. Dies tat ich mit der Absicht, mich anschliessend bei der Swissair zu bewerben. Zuerst packte mich jedoch die Abenteuerlust. Nach dem Aufenthalt in einer Sprachschule in Perth reiste ich mit einer Freundin quer durch Australien. Wir waren gerade mal 18 Jahre alt.
Dann war es an der Zeit, mich auf meine Karriere zu konzentrieren. Nach einer kaufmännische Lehre im Carlton Elite Hotel in Zürich trat ich eine saisonale Anstellung im Badrutt’s Palace Hotel in St.Moritz an.
Was hast du im Palace Hotel in St.Moritz fürs Leben gelernt?
Lass mich mal nachdenken. Es ist alles ein bisschen verschwommen – vermutlich weil ich praktisch jede Nacht in den Ausgang bin und viel zu viel Bier konsumiert hatte :-)
Ich würde sagen, dass ich generell in der Schweiz gelernt habe, was ich hier in Amerika ein bisschen vermisse: Persönliche Disziplin und Verantwortung. Beides ist notwendig, um im Berufsleben erfolgreich zu sein.
Ein Beispiel: Das Kläger-Business in den USA treibt mich in den Wahnsinn. Da kauft jemand bei McDonald‘s einen Kaffee, verbrennt sich die Zunge, verklagt dann den Fastfood-Riesen und kriegt als Entschädigung 1 Million Dollar????? Ich verstehe das nicht. Solche Situationen sind inzwischen normal – Gemeinsinn wird nicht mehr verlangt.
Bei einer Reise nach Kanada (1997) machte ich Bekanntschaft mit der Familie Willis von Anchorage, die nicht nur Islandpferde sondern auch Schlittenhunde hatten. Bernie und Jeannette Willis haben mich spontan für ein paar Wochen nach Alaska eingeladen. Das war mein erster Aufenthalt in Alaska.
Nach einer letzten Saison im Palace Hotel wanderte ich 1999 nach Alaska aus und im selben Jahr heiratete ich Andy (Bernies & Jeannettes ältester Sohn).
2001 haben Andy und ich eine eigene Lodge aufgebaut. Wir haben das Grundstück mit Gebäude an einer Auktion gekauft und für ein Jahr lang geputzt, aufgeräumt, geflickt und renoviert.
Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Kindheitstraum von der eigenen Fishing und Hunting Lodge erfüllen könnte. Mein Leben war voller Abenteuer: Wir hatten unsere eigene Lodge, haben den ganzen Sommer über gefischt, im Herbst und Frühling gejagt und im Winter Schlittenhunde trainiert.
Andy und seine Family engagierten sich sehr stark für das weltberühmte Schlittenhunderennen Iditarod. Alle Männer haben in unterschiedlichen Jahren am Rennen teilgenommen. In den Jahren 2007 und 2008 hatten wir ein ziemlich gutes Hundeteam zusammen – und jetzt war ich an der Reihe, das 1000-Meilen lange Hunderennen zu absolvieren. Ich war die erste Schweizer Frau, die am Iditarod teilgenommen hat.

FotogalerieSilvia Brugger in Alaska
(Images: Trent Grasse)
Was fasziniert dich an Schlittenhunden und an Schlittenhunderennen?
Was fasziniert dich an Schlittenhunden und an Schlittenhunderennen?


Ich mochte schon immer den Umgang mit Tieren. Ich bin in einer Wohnung aufgewachsen, wo wir nur zwei Katzen halten konnten - unseren ersten Hund (Golden Retriever) hatten wir, als ich ungefähr 16 Jahre alt war und wir in ein Haus umgezogen sind.
Die Schlittenhunde sind natürlich nicht mit Haushunden zu vergleichen – das sind „Arbeitshunde“. Über Generationen wurden die als Zugtiere gehalten und zum Arbeiten gebraucht.
Es war natürlich schön, einfach mit den Hunden rauszugehen = 30 oder 40 Meilen :)
Ich bin ein Bewegungsmensch und liebe Herausforderungen. Deshalb wollte ich die Schlittenhunde nicht nur zum Spass halten und habe relativ rasch an kleinen Rennen teilgenommen (200 und 300 Meilen). Dafür stellte ich mir ein Team von zirka 20 Hunden zusammen, die später dann am Iditarod teilnehmen konnten. Die Vorbereitung hat insgesamt sieben Jahre gedauert. Ich habe alle Hunde selber aufgezogen und zusammen mit meinem Ehemann trainiert.
Ein Auslauf mit den Schlittenhunden vermittelt ganz viele verschiedene Gefühle! Er ist abenteuerlich und manchmal sogar gefährlich. Vieles kann schief gehen. In der Wildnis kann man sich schnell verirren. Aggressive Elche können die Hunde angreifen und verletzen oder sogar töten. Dann natürlich die Kälte: Temperaturen von -30 und -40 Grad sind nicht selten. Von November bis Januar sind die Tage sehr kurz (10-15 Uhr). Das macht das Training sehr anspruchsvoll, wenn man von morgens um 8 Uhr bis abends um 6 Uhr trainieren muss.
Aber die anstrengende Arbeit lohnt sich! Später im Winter (Februar und März) werden die Tage wieder länger und in einem normalen Jahr sind die Schneeverhältnisse ideal und die Temperaturen angenehm (um die -10 bis -20 Grad). Unter solchen Verhältnissen kann ich mir schlicht nichts schöneres vorstellen, als mit zwölf top-trainierten Schlittenhunden auf einen „Run“ zu gehen. Neben der Atmung der Hunde herrscht absolute Stille! Ich bekomme dann richtig Gänsehaut. Und wenn man Nachts draussen ist kann man häufig das Polarlicht bestaunen.
Und dann natürlich die persönliche Herausforderung, an einem Rennen teilzunehmen – vor allem am legendären Iditarod! 1000 Meilen sind sehr weit. Je nach Wetter und Zustand der Route braucht der Sieger zirka neun Tage. Ein absolviertes Rennen ist der grösste Gewinn für die harte Arbeit.
Für die 1000 Meilen benötigte ich 10 Tage. Genaue Daten findest du über die Webseite www.iditarod.com (in „Archiv“ solltest du mich unter Silvia Willis finden - 2007 und 2008)
2007 war mein „Rookie Year“ (Rookie = jemand, der zum ersten Mal an einem Rennen teilnimmt).
Jeder Tag war ein Abenteuer und als Rookie weiss man nie, was einem erwartet. Das Wetter nicht so schlecht. Es war jedoch eines der kältesten Jahre – viele Teilnehmer (Hunde & Menschen) kämpften mit Erfrierungserscheinungen. Im Ziel war mein ganzes Gesicht geschwollen. Auch hatte ich eine üble Infektion in meiner linken Hand und musste an einem Checkpoint notfallmässig unters Skalpell. Ein Pfleger (kein Doktor!), der seine Zeit gratis dem Rennen zur Verfügung stellte, hatte eine kleine Erste-Hilfe-Tasche bei sich.
Auf die Dauer war dieser Lebensstil jedoch für unsere Ehe zu stressig und Andy und ich haben uns bald darauf getrennt. Ich bin von der „Wildnis“ in die Stadt gezogen und führe jetzt ein „zivilisiertes“ Leben.
Die Hunderennen bereiteten mir sehr viel Spass und ich vermisse sie. Die Hunde waren aber auch sehr anspruchsvoll. Ferien konnten wir keine machen, weil die Hunde jeden Tag gefüttert werden mussten. Gleichzeitig war die Trainingspause im Sommer (wenn es zu heiss ist) die Hochsaison in unserer Lodge.
Nun arbeite ich für K&L Distributors als Beer Sales Team Leader und habe sechs Angestellte.
Was machst du da genau?
K&L Distributors Inc. ist eine Vertretung von alkoholischen Getränken in Alaska. Ich bin für den Bierverkauf in rund achtzig Alkohol-Shops in Anchorage, Wasilla und Palmer zuständig.
Das ist vermutlich viel mehr Information als du brauchst, aber hoffentlich gibt es dir ein Bisschen einen Einblick in meine Geschichte.
Was vermisst du aus der Schweiz?
Ich vermisse viele Sachen. Der öffentliche Verkehr ist im Vergleich zu Alaska unschlagbar. Alaska ist flächenmässig so gross, dass ein ÖV gar nicht finanzierbar wäre. Auch vermisse ich die vielen Wanderwege. Alaska hat zwar viel Natur und Berge, aber das meiste ist sehr abgelegen und potenziell gefährlich (wilde Tiere). Als Schweizerin bin ich natürlich auch verwöhnt, wenn es um Schokolade geht – ich fülle alle meine Taschen, wenn ich von der Schweiz nach Hause nach Alaska fliege.
Regelmässig vergleiche ich Alaska mit der Schweiz und frage mich, wo ich lieber den Rest meines Lebens verbringen möchte. Soll ich wieder in Schweiz zurückziehen, um meiner Familie näher zu sein? Wo sind die wirtschaftlichen Verhältnisse und das Gesundheitswesen besser? Und so weiter, und so fort.
Der Weg zu einer „richtigen“ Antwort ist lang. Beide Länder (USA und CH) haben positive und negative Seiten und es ist nicht einfach, diese gegeneinander abzuwägen.
In den USA ist es einfacher, meine persönliche Freiheit und meine Träume zu realisieren. Und wenn ich „USA“ schreibe, dann meine ich Alaska. Ich könnte mir ein Leben in einer Grossstadt wie New York, Los Angeles oder Chicago nie vorstellen. Alaska ist mit der Schweiz vergleichbar – ich mag vor allem die Berge.
Ich habe den Eindruck, dass die Schweiz sehr reguliert ist – zu viel ist staatlich vorgeschrieben. Die Schweiz ist relativ klein und sehr dicht bevölkert – bei Besuchen kriege ich fast klaustrophobische Zustände.
Wie pflegst du die Kontakte zu deinen Freunden und Verwandten in der Schweiz?
Kontakt habe ich praktisch nur noch via Facebook – das geniesse ich allerdings sehr. Es ist schön, auf diesem Weg mitzukriegen, was die ehemaligen Schulkameraden heute machen. Ohne Facebook hätte ich da keine Ahnung. Und dank „Hangout“ bin ich auch regelmässig mit meinen Geschwistern und unserem Vater in Kontakt. Etwa alle zwei Monate treffen wir uns am Sonntag Morgen online.
Ich lebe seit 17 Jahren in den USA – und, obwohl Amerika nicht perfekt ist, ich kann hier meine persönlichen Träume einfacher verwirklichen. Ich weiss nicht genau, wie ich mich besser ausdruecken kann – mir fehlen die richtigen Worte.
In der Schweiz war mein Leben verplant: zur Schule gehen, eine Lehre absolvieren, eine Stelle finden, für den Rest des Lebens arbeiten und für die Pensionierung sparen.
Auch mache ich mir mehr Sorgen über die politische und ökonomische Lage in Europa als in Amerika. Aber die ganze Welt ist im Wandel. Wir sind alle davon betroffen, egal wo wir wohnen. In Alaska sind wir von den natürlichen Ressourcen abhängig und momentan kämpfen wir mit einem gigantischen staatlichen Multi-Milliarden-Defizit. Das bereitet allen Sorgen und die Zukunft ist ungewiss. Gleichzeitig bin ich auch über die europäische Lage besorgt. Deshalb finde ich es gut, dass die Schweiz nie der EU beigetreten ist. Dadurch ist sie etwas von einem negativen ökonomischen Einfluss geschützt. Aber die Schweiz ist nichtsdestotrotz in Europa und umgeben von EU-Staaten und dadurch beeinflusst.
Ich habe die Schweiz nicht verlassen, weil es mir nicht gefallen hat. Ich hatte die Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern und habe diese genutzt. Ich bin stolz auf meine Herkunft, liebe mein Heimatland und reise gerne in die Schweiz auf Besuch – aber am Ende jedes Schweizer Aufenthalts freue ich mich auch wieder „nach Hause“ nach Alaska zu fliegen.

Hostettlers
Christine und Hans HostettlerVom Berner Oberland in den Urwald ParaguaysMarcela Aguila (Text), Rodrigo Muñoz (Bilder)
Die Hostettlers Paradies in Paraguay
Die Hostettlers Paradies in Paraguay


"Ob wir in die Schweiz zurückkommen wollen. Nein!", antwortet Christine, ohne zu zögern. "Hier haben wir eine Freiheit und Chancen, Dinge zu tun, die wir uns in der Schweiz nicht einmal hätten vorstellen können."
Eine Freiheit, die sie breit nutzten: Sie gründeten einen Naturschutz-Verein und ein Ökotourismus-Programm, sowie einen Biobauernhof, dem sie zu Ehren ihres Geburtsortes den Namen "New Gambach" gaben. Hier treffen wir sie und geniessen ihre Gastfreundschaft, während sie ihre Erinnerungen an 36 Jahre als Bürger der "Fünften Schweiz" mit uns teilen.
Sie sprechen über ihre Nostalgie, über Familie und Freunde, über die Kultur der Schweiz, über deren Organisation, "Ordnung und Sauberkeit". Ihr Zuhause jedoch, unterstreichen sie, sei heute hier. Ein Zuhause, das Hans mit eigenen Händen in Alto Vera, Itapúa, erbaute, und das an das Reservat des Nationalparks San Rafael grenzt.
Ein gefährliches Engagement
Eine Nähe, die viel bedeutet. Die Geschichte der Hostettlers ist eng verbunden mit der Geschichte der Verteidigung der letzten Bastion des Atlantischen Regenwalds in Paraguay: Eines der reichsten Ökosysteme des Planeten, aber auch eines der am stärksten bedrohten.
Und wenn wir schon von Gefahren sprechen, diesen einen Sonntag 2008 werden die Hostettlers nicht so rasch vergessen: "Es wurde Fussball gespielt. Ich war allein im Haus, als ich draussen Lärm hörte. Ich ging heraus und fand mich Auge in Auge mit einem Maskierten, der einen 38mm-Revolver auf mich richtete." Bis heute weiss Christine nicht, ob sie einfach Glück hatte, oder ob der Angreifer schlecht zielte; auf jeden Fall traf sie die Kugel nicht, die losgegangen war. Auch Hans wurde nicht verletzt, als Unbekannte einmal auf sein Flugzeug schossen, als er über den Urwald flog, um nach illegalen Rodungen, Bränden oder illegal angebauten Pflanzen Ausschau zu halten.
"Sie dachten, wenn sie uns töten würden, wäre der Kampf vorbei. Doch heute wissen sie, dass wir mehrere sind", erklärt unsere Gastgeberin.
Die Kälte des Oberlands
Doch kommen wir zurück zum Beginn ihres Abenteuers, gegen Ende der 1970er-Jahre im Berner Oberland. Das Leben der Familie Hostettler in Gambach, in der Gemeinde Rüschegg, verläuft friedlich. Zu friedlich. Als sie herausfinden, dass man auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans Parzellen erwerben kann, sagt sich das Paar, "das versuchen wir".
Mit Unterstützung der Familie kaufen sie 250 Hektaren Land in der Neuen Welt. Diese ist für sie zwar wirklich eine neue Welt, die auf sie aber eher archaisch wirkt. "Es schien, als wären es 50 Jahre früher", erklärt Christine, und ruft das ungastliche Paradies in Erinnerung, in das sie damals aufbrachen, und in dem es nicht die geringste Infrastruktur gab. In der Schweiz war es zwar kalt und eintönig, aber wenigstens hatte es Komfort und Sicherheit gegeben.
Christine verliess die Schweiz im Februar 1979, mit Brigitte, der ältesten Tochter des Paars, in den Armen. Hans war schon sechs Monate früher ausgewandert, um das Terrain vorzubereiten, im wörtlichen Sinn: Der ehemalige Seemann musste die Bäume auf dem Flecken Land fällen, das Unkraut ausreissen, bevor er ein Holzhaus für seine Familie bauen konnte.
Im Lauf der Zeit baute der handwerklich geschickte Hans das Haus weiter aus. Für die Stromversorgung errichtete er einen Damm, der Stausee dahinter wurde zu einem Biotop. Dank seiner Geschicklichkeit gelang es ihm auch, die Mähmaschine betriebsbereit zu halten und die Teile eines ultraleichten Flugzeugs zusammenzubauen, die er mit der Post erhalten hatte.

FotogalerieDas Paradies der Hostettlers im Guaranì-Wald
(Text: Marcela Aguila; Bilder: Rodrigo Muñoz)
Jahre des Kampfes
Jahre des Kampfes


Doch parallel dazu begann der Bauernhof Früchte zu tragen – genauer gesagt, Milch. Christine lernte, Käse zu machen (in Paraguay, nicht in der Schweiz). Und Brigitte erhielt eine Schwester und einen Bruder, Teresa und Pedro. Heute läuft der biologische Sojaanbau gut, und die Familie Hostettler ist voll und ganz im Kampf für die Umwelt engagiert.
In der Tat ist das Flugzeug, das mit Hilfe des WFF erworben wurde, Teil der Unterstützung, die der Verein Pro Cosara, der sich für die Verteidigung dieses Naturschutzgebietes einsetzt, von ausserhalb erhält. 1997 auf Anstoss des Paares gegründet, wacht die Organisation über die seit 1922 geschützte Zone und versucht, Land von privaten Besitzern zu erwerben, die von der Regierung nicht entschädigt worden waren.
Diese Situation verhinderte bisher, dass die insgesamt 73'000 Hektaren umfassende Zone zu einem "Öko-Park" erklärt wurde. Der Landstrich ist durch extensive Agrarkulturen bedroht – vor allem Sojaanbau, aber auch illegale Plantagen – und durch illegalen Holzschlag.
Neue Front
Christine und ihr Team arbeiteten unermüdlich, um den Verein zu stärken, der heute über ein bedeutendes internationales Unterstützungs- und Kontaktnetz verfügt. Er setzt Forschungsprogramme um, um den Bestand des Naturschutzreservats zu erfassen. Daneben organisiert er ökologische Ausbildungsprogramme zur Sensibilisierung der Leute und zur Entwicklung von nachhaltigen Aktivitäten.
Pro Cosara ist auf gutem Wege. Im vergangenen Februar hat Christine die Leitung aufgegeben, gehört aber nach wie vor dem Beirat des Vereins an. Und hat im Kampf für den Erhalt der Natur eine neue Front eröffnet: Ein Ökotourismus-Projekt. Jüngst waren Studierende aus den USA hier und inventarisierten in der Umgebung über 70 verschiedene Vogelarten.
Ein wahres Paradies. Aber auch die Landschaften im Berner Oberland, aus dem sie kamen, sind idyllisch. Ist die Entscheidung, auszuwandern, die richtige gewesen? "Die beste", antwortet Christine, ohne zu zögern. Neben der Freiheit schätzt das Paar die Chance, dass seine Kinder in Kontakt mit der Natur aufwachsen konnten, und mit dem Respekt für die Umwelt.
Die Schweiz – noch immer präsent
Haus, Familie, Bauernhof, Pflanzenanbau, Einsatz für die Umwelt: All dies reicht für ein ausgefülltes, intensives Leben. Dennoch blieb das Land, in dem sie geboren wurden, auch hier immer präsent.
Die beiden Töchter der Familie leben heute in der Schweiz, und das Paar selber kehrt regelmässig dorthin zurück. Und in Paraguay beteiligen sie sich an den Aktivitäten anderer Auslandschweizer. Während fünf Jahren arbeitete Christine zudem als Freiwillige darauf hin, dass pensionierte Schweizer und Schweizerinnen in der Region weiter ihre Renten erhalten.
Wie sieht Christine heute, fast 40 Jahre nach ihrer Auswanderung, ihre ursprüngliche Heimat? "Es gab einen radikalen Wandel. Es ist nicht mehr die Schweiz unserer Erinnerungen. Unsere Eltern hatten während vielen Jahren mit Ausländern gearbeitet, die ihre Rechte hatten, aber nicht versuchten, ihre eigene Kultur durchzusetzen. Heute scheint die Situation anders zu sein, und ich befürchte den Verlust der Schweizer Identität."
Und was würde sie Menschen empfehlen, die in Betracht ziehen, die Schweiz zu verlassen? "Bevor sie einen definitiven Entscheid fällen, sollten sie in das Land ihrer Wahl reisen und dort mindestens drei Monate verbringen. Es gibt Leute, die schicken Container mit ihrem Hab und Gut zum Voraus, geben ihre Ersparnisse aus und realisieren erst zu spät, dass ihre Wahl nicht ihren Vorstellungen entspricht."
Trotz ihrem jugendlichen Enthusiasmus hatten Christine und Hans Hostettler damals, als sie die Schweiz verliessen, nicht all ihr Hab und Gut mitgenommen. Ihre Möbel zum Beispiel sind noch viele Jahre in Rüschegg geblieben. Tatsächlich kamen ihre letzten Objekte erst vor nicht so langer Zeit in Paraguay an. Sie sind zwar wirklich ausgewandert, haben aber nicht alle Brücken abgebrochen.

Bruno Manser
Bruno ManserBruno Manser – zurück zur EinfachheitRuedi Suter (Text), Bruno Manser Fonds (Bilder)
Bruno Manser Martyrium in Malaysia
Bruno Manser Martyrium in Malaysia


"Das erhebliche Interesse am Stumm-Machen von Bruno Manser durch die malaysische Regierung und die Holzkonzerne ist belegt", erklärte das Basler Zivilgericht Ende 2003 im Verschollenen-Verfahren. Manser, in Basel aufgewachsen, liebte das Leben. Doch nicht um den Preis der Ignoranz, der Zerstörung, der Ausbeutung. Nicht um den Preis der Industriegesellschaft, in der er aufgewachsen war. Denn zu oft lebt sie auf Pump, lebt durch Raubbau an den Urvölkern und der Natur. Der Überflussgesellschaft stellte er seine Askese entgegen: Sein Leben war ein radikaler Weg zurück zur Einfachheit. Deshalb verweigerte er sich dem modernen Lebensstil, wo immer es ihm möglich war – mit Intelligenz, Kreativität, Sturheit und Humor.
Manser verzichtete aufs Studieren, wurde Meistersenn, wurde Schafhirte. Elf Jahre verbrachte er im Gebirge. "Ich wollte mir das Wissen über alles aneignen, was wir im täglichen Leben brauchen." Er suchte sich ein Volk mit Jägern und Sammlern, die wie vor Urzeiten lebten und bei denen er alles Gelernte anwenden konnte. Im technisierten Europa war kein derartiges Volk mehr zu finden. So reiste er 1984 nach Borneo, in den malaysischen Teilstaat Sarawak. Dort schlug er sich unglaublich wagemutig durch den Urwald, um bei den Penan tatsächlich jene 300 Familien zu finden, die noch als Vollnomaden durch die Regenwälder zogen.
Und sie nahmen den seltsamen Fremden bei sich auf. Dieser warf alles weg, was er mitgebracht hatte: Kleider, Notfall-Apotheke, Zahnpaste, Schuhe. Nur die Brille behielt der Kurzsichtige auf der Nase. Er zwang sich zum Barfussgehen, litt zuerst, hatte dauernd offene Füsse, musste sich regelmässig mit dem Messer Dornen herausoperieren. Er lernte die Schmerzen ertragen, denn wer wie die Penan im Dschungel lebt, muss die Schmerzen als Selbstverständlichkeit akzeptieren. Das Barfussgehen wurde zur Gewohnheit. Es war ein Befreiungsakt: Er, der Mensch der Moderne, war nicht mehr auf Schuhe angewiesen. Ein Sieg über sich selbst!
Einer von ihnen
Rasch erwarb er sich hohes Ansehen. Kompromisslos passte er sich den Penan an. Barfussgehen, Nacktsein, Hunger, Feuchtigkeit, Insekten, Blutegel, aber auch Hautgeschwüre und Malaria prägten seinen Alltag. Schliesslich bewegte sich der Brillenträger wie ein Penan durch den Dschungel, bahnte sich geschickt mit dem Buschmesser seinen Weg, ruhte in der Hockstellung der Nomaden aus, durchschwamm angeschwollene Flüsse, baute sich hoch in Baumkronen sein Nachtlager.
Das einfache Leben der Waldnomaden gefiel ihm. Es war, als hätte er seine Familie aus einem früheren Leben wieder gefunden. Er wollte nicht mehr zurück in die Schweiz mit ihrer Enge, ihren Abgasen, ihrem Lärm und all den Menschen, die sich mit dem Erdrosseln der Artenvielfalt immer mehr vom natürlichen Leben entfernten, mit Technik, Geldverdienen und Unterhaltungsindustrie einem Lebenssinn nachjagten, der sie nur immer verlorener oder trauriger machte. Nein, hier bei diesen einfachen und warmherzigen Menschen wollte er bleiben, mit ihnen leiden oder glücklich sein und sich an dem Leben spendenden Urwald erfreuen. Dies alles trotz des latenten Heimwehs, das nicht die Schweiz, sondern die Erinnerung an seine Familie und all seine Freunde in ihm auslöste. Ein Seelenschmerz, der ihn immer wieder nach Hause Briefe schreiben und Tonbandaufnahmen schicken liessen, ihn aber nie zwingen würden, freiwillig seine neue Regenwaldfamilie zu verlassen. Ja, er war angekommen! In seinem Paradies, das er sich so vorgestellt hatte. Nichts sollte ihn von hier jemals vertreiben können.
So wurde er für die Penan zu einem der ihren, zum "Laki Penan". Auch er kannte nun das Wild, fischte mit dem Wurfnetz, jagte mit Blasrohr und Giftpfeil, mit Speer und Flinte Bären, Affen, Wildschweine, Hirsche und Vögel, sammelte Waldfrüchte und stellte aus wilden Palmherzen das Sagomehl her. Er lernte die Sprache, notierte seine Beobachtungen, fertigte unzählige Dokumente von Menschen, Tieren und Pflanzen an. Vielleicht ahnte er dabei schon die Vernichtung dieser gewaltigen Baumwelt mit ihren klaren Gewässern, ihrem Wild- und Pflanzenreichtum.
Denn bereits ist der Wald vielerorts von den Holzkonzernen zerstört – mit dem Segen einer Regierung, welche die Landrechte und wachsende Not der von den Waldfrüchten lebenden Ureinwohner ignorierte. Für die Politiker in Sarawaks Provinzhauptstadt Kuching ist der Regenwald nur ein Selbstbedienungsladen: Das hochwertige Hartholz der Baumriesen wird verkauft, um in den Industrieländern die Konsumenten mit Dachbalken, Möbeln, Luxusyachten, Fensterrahmen und Besenstilen zu versorgen.

FotogalerieRegenwald-Aktivist
(Bilder: Bruno Manser Fonds)
Staatsfeind Nummer 1
Staatsfeind Nummer 1


Nun kamen auch Filmteams, die den Sonderling als mutigen Regenwaldschützer ins Rampenlicht rücken. Für die Weltpresse wurde der "Weisse Wilde" zum Sprecher der Penan. Sein Auftreten war bescheiden, die Stimme ruhig, die Sprache ehrlich. Und plötzlich hörte die Welt zu. Manser, der Architekt des Widerstandes, wurde zum Symbol der Rebellion gegen das Abholzen der Regenwälder.
"Aufgerüttelt durch die Tatsache, dass der Lebensraum der Penan in Form von Billigholz dem internationalen Markt geopfert wird, kehrte ich 1990 in die Schweiz zurück, um ihre Stimme – 'Baut Eure Häuser nicht aus unserem Wald' – in unserer Zivilisation erklingen zu lassen." In Basel baute er mit Hilfe des Menschenrechtlers Roger Graf den unterdessen zu einer schlagkräftigen Regenwaldschutz-Organisation entwickelten "Bruno-Manser-Fonds" (BMF) auf. Hauptziel: Der Verzicht der Konsumentinnen und Konsumenten aller Industrieländer auf Tropenholz.
Klar benannte der BMF die Symbiose zwischen den Jäger- und Sammlervölkern und ihrem Lebensraum: "Stirbt der Wald, sterben die Menschen". Sanft in der Art, doch unbeugsam in der Sache schilderte er vor internationalen Gremien wie der EU, der UNO und der Internationalen Tropenholz-Organisation ITTO die verzweifelte Situation der Penan. In der Schweiz lebte er höchst bescheiden, arbeitete rund um die Uhr, reiste viel. So kämpfte er sich immer wieder auf Borneo in Gewaltmärschen zu den Penan durch. Er wurde radikaler, spürte, dass den Penan die Zeit davonlief.
Die Spur verliert sich
Manser machte in der Schweiz einen Aufsehen erregenden Hungerstreik, um eine Deklarationspflicht für Holz und Holzprodukte zu erzwingen. Vergebens: "Die Satten wollen die Hungrigen nicht verstehen." Der Wald in Sarawak schrumpfte weiter, die Tiere waren vertrieben oder gewildert. Das einst gesunde Volk der Penan war am Verelenden. 1996 sind 70% des Urwaldes vernichtet. Nun machte der Regenwaldschützer mit tollkühnen Aktionen in Europa und Sarawak auf seine Anliegen aufmerksam. Es nützte alles nichts. 2000 brach Bruno Manser erneut nach Borneo auf – und verschwand für immer.
Ist er ermordet und spurlos beseitigt worden? Das wäre die wahrscheinlichste Todesursache, doch konnte sie bisher ebenso wenig belegt werden wie ein Unfall oder der Freitod. Sein spurloses Verschwinden bleibt ein Rätsel. Heute warten seine Verwandten und Freunde nicht mehr auf Bruno. Sie spüren, dass er da ist, in ihren Herzen, ihren Gedanken. Hin und wieder dünkt sie, sie würden seine kräftige Stimme hören, die sagt: "Nur die Taten zählen – auch deine."
Ruedi Suter, Autor des Buches "Bruno Manser – Die Stimme des Waldes"

Links
Zum Thema

Wir fragten 12 Auslandschweizer, wie sie aus der Ferne über die Schweiz denken
Schweizerinnen und Schweizer leben über die ganze Welt verstreut. Dank Instagram haben wir einige von ihnen aufgespürt. Wie verändert die Distanz ihre Sicht auf die Schweiz?
Immer mehr Auslandschweizer
2018 hat die Zahl der im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer um 1,1% zugenommen. Die Schweizer Diaspora zählt heute 760'200 Menschen. Das beliebteste Ziel für Auswanderer bleibt Frankreich, gefolgt von Deutschland, den Vereinigten Staaten und Italien.
Wie sich Auslandschweizer über ihre Heimat informieren
Fernsehen über Satellit oder via Internet, kostenlose Informations-Sites oder "Paywall" der wichtigsten Schweizer Tageszeitungen: Im Vorfeld der Abstimmung über die "No-Billag"-Initiative haben wir die Follower unserer Facebook-Seiten gefragt, welche Informationsquellen sie nutzten, um über das Geschehen in der Schweiz auf dem Laufenden zu bleiben. Hier ist eine kleine Auswahl.
Ein Schweizer bei den letzten Penan-Nomaden
Der Fotograf Tomas Wüthrich gibt einen Einblick in das Leben der Penan, einem indigenen Stamm aus dem Sarawak-Regenwald in Malaysia. Von der Jagd mit dem Blasrohr bis zur Abholzung des Regenwaldes erzählen seine Bilder vom Alltag einer bedrohten Existenz. "Ich bin aber nicht der neue Bruno Manser", sagt er.

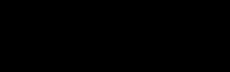























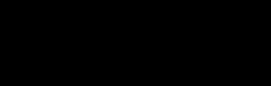 Die Schweiz, ein goldener Käfig?
Die Schweiz, ein goldener Käfig?
 Vorankommen in einem Land, das am Aufholen ist
Vorankommen in einem Land, das am Aufholen ist
 Niklaus Mueller
Niklaus Mueller
 MBA-Student in Schanghai
MBA-Student in Schanghai
 Goldenes Sicherheitsnetz
Goldenes Sicherheitsnetz
 Der Elefant im Zimmer
Der Elefant im Zimmer
 Blaettler Schwestern
Blaettler Schwestern
 Das Leben an der Küste Kenias geniessen
Das Leben an der Küste Kenias geniessen
 Afrikanische Realität
Afrikanische Realität
 Bei den tansanischen Massai Erfüllung finden
Bei den tansanischen Massai Erfüllung finden
 Tansanische Kunst
Tansanische Kunst
 Ein Briefwechsel mit der ersten Schweizer Frau, die am Iditarod in Alaska teilgenommen hat
Ein Briefwechsel mit der ersten Schweizer Frau, die am Iditarod in Alaska teilgenommen hat
 Silvia Brugger
Silvia Brugger
 Silvia Brugger in Alaska
Silvia Brugger in Alaska
 Was fasziniert dich an Schlittenhunden und an Schlittenhunderennen?
Was fasziniert dich an Schlittenhunden und an Schlittenhunderennen?
 Vom Berner Oberland in den Urwald Paraguays
Vom Berner Oberland in den Urwald Paraguays
 Die Hostettlers
Die Hostettlers
 Das Paradies der Hostettlers im Guaranì-Wald
Das Paradies der Hostettlers im Guaranì-Wald
 Jahre des Kampfes
Jahre des Kampfes
 Bruno Manser – zurück zur Einfachheit
Bruno Manser – zurück zur Einfachheit
 Bruno Manser
Bruno Manser
 Regenwald-Aktivist
Regenwald-Aktivist
 Staatsfeind Nummer 1
Staatsfeind Nummer 1
 Zum Thema
Zum Thema
 Manchmal können auch die Hände einen Beitrag zur besseren Verständigung leisten.
Manchmal können auch die Hände einen Beitrag zur besseren Verständigung leisten.
 Viele Chinesen sagen ihrem Land eine goldene Zukunft voraus.
Viele Chinesen sagen ihrem Land eine goldene Zukunft voraus.
 Ein Blick aus der Ferne in die Ferne?
Ein Blick aus der Ferne in die Ferne?
 Ein Souvenir vom Markt?
Ein Souvenir vom Markt?
 In Kontakt bleiben.
In Kontakt bleiben.
 Die Strasse zu Danielas Zuhause in Malindi.
Die Strasse zu Danielas Zuhause in Malindi.
 Daniela ist zwar der Schweiz entflohen, nicht aber der Büroarbeit.
Daniela ist zwar der Schweiz entflohen, nicht aber der Büroarbeit.
 Abendessen mit ihren vier adoptierten Kindern und jenen Leuten, die für sie arbeiten.
Abendessen mit ihren vier adoptierten Kindern und jenen Leuten, die für sie arbeiten.
 Auf dem Weg, um ihre Kinder von der Schule abzuholen.
Auf dem Weg, um ihre Kinder von der Schule abzuholen.
 Das Zuhause in Malindi nutzt Daniela auch für Workshops.
Das Zuhause in Malindi nutzt Daniela auch für Workshops.
 Daniela verbringt nach der Schule "Quality Time" mit ihren adoptierten Kindern.
Daniela verbringt nach der Schule "Quality Time" mit ihren adoptierten Kindern.
 Alte Fischerboot-Segel in trendige Taschen umwandeln.
Alte Fischerboot-Segel in trendige Taschen umwandeln.
 Daniela hat eine Schwäche für Herzmotive. Sie sind ein deutliches Merkmal ihrer Taschenkollektion.
Daniela hat eine Schwäche für Herzmotive. Sie sind ein deutliches Merkmal ihrer Taschenkollektion.
 Der Ali Lamu Workshop bedeutet stets viel Arbeit.
Der Ali Lamu Workshop bedeutet stets viel Arbeit.
 Daniela macht eine Pause, während Shueb das Essen zubereitet.
Daniela macht eine Pause, während Shueb das Essen zubereitet.
 Daniela geniesst es, ihre adoptierten Kinder zu bemuttern. Das Ende des Schultags bedeutet den Beginn der Familienzeit.
Daniela geniesst es, ihre adoptierten Kinder zu bemuttern. Das Ende des Schultags bedeutet den Beginn der Familienzeit.
 Die Arbeit ist weit entfernt, wenn Daniela Zeit mit ihren Kindern verbringt.
Die Arbeit ist weit entfernt, wenn Daniela Zeit mit ihren Kindern verbringt.
 Jeden Montag Morgen trifft sich das ganze Verkaufsteam im Büro und wir planen die Aktivitäten der anstehenden Woche.
Jeden Montag Morgen trifft sich das ganze Verkaufsteam im Büro und wir planen die Aktivitäten der anstehenden Woche.
 Im Gespräch mit einem guten Kunden, Bryan Swanson, der in Anchorage drei Getränkeläden besitzt.
Im Gespräch mit einem guten Kunden, Bryan Swanson, der in Anchorage drei Getränkeläden besitzt.
 2015 hat K&L Distributors rund 2.7 Millionen Kisten Bier verkauft.
2015 hat K&L Distributors rund 2.7 Millionen Kisten Bier verkauft.
 Umgekehrt pflegen auch unsere Lieferanten mit uns einen Austausch.
Umgekehrt pflegen auch unsere Lieferanten mit uns einen Austausch.
 Hier besuchten uns Vertreter der kalifornischen Brauerei Lagunitas.
Hier besuchten uns Vertreter der kalifornischen Brauerei Lagunitas.
 Ich fahre so oft wie möglich in die Natur.
Ich fahre so oft wie möglich in die Natur.
 Zum Beispiel zum Fischen an den "Bird Creek".
Zum Beispiel zum Fischen an den "Bird Creek".
 Der "Bird Creek" liegt nur 20 Minuten von Anchorage entfernt und ist für die Silberlachs-Fischerei bekannt.
Der "Bird Creek" liegt nur 20 Minuten von Anchorage entfernt und ist für die Silberlachs-Fischerei bekannt.
 Diesen Schwarzbären erlegte ich vor rund zehn Jahren in Beluga. Die drei Golden Retrievers sind meine besten Freunde.
Diesen Schwarzbären erlegte ich vor rund zehn Jahren in Beluga. Die drei Golden Retrievers sind meine besten Freunde.
 Nur "Musher" (Hundeschlittenlenker), die das legendäre Hundeschlittenrennen Iditarod beendet haben, dürfen in Alaska diese spezielle Autonummer besitzen. Die Nummer 22 steht für meine beste Platzierung (2008).
Nur "Musher" (Hundeschlittenlenker), die das legendäre Hundeschlittenrennen Iditarod beendet haben, dürfen in Alaska diese spezielle Autonummer besitzen. Die Nummer 22 steht für meine beste Platzierung (2008).
 Mit meinen Hunden mache ich gerne kleine Wanderungen.
Mit meinen Hunden mache ich gerne kleine Wanderungen.
 Die beiden hellen Hunde heissen Myla (16 Jahre alt) und Oscar (Sohn von Myla). Sie werden wohl nicht mehr lange leben. Deshalb habe ich mich letztes Jahr entschieden, einen neuen Hund in die Familie zu bringen.
Die beiden hellen Hunde heissen Myla (16 Jahre alt) und Oscar (Sohn von Myla). Sie werden wohl nicht mehr lange leben. Deshalb habe ich mich letztes Jahr entschieden, einen neuen Hund in die Familie zu bringen.
 Weit entfernt von Menschen, aber nicht komplett isoliert: Hans Hostettler mit einem Freund und seinem treuen Hund Albi vor seinem Haus.
Weit entfernt von Menschen, aber nicht komplett isoliert: Hans Hostettler mit einem Freund und seinem treuen Hund Albi vor seinem Haus.
 Christine Hostettler in ihrem Arbeitszimmer.
Christine Hostettler in ihrem Arbeitszimmer.
 Hans und Christine Hostettler organisieren für Reisende verschiedene Aktivitäten des Ökotourismus.
Hans und Christine Hostettler organisieren für Reisende verschiedene Aktivitäten des Ökotourismus.
 Christine Hostettler hat in Paraguay gelernt, Käse herzustellen.
Christine Hostettler hat in Paraguay gelernt, Käse herzustellen.
 Hans Hostettler geniesst seit über 35 Jahren die üppige Vegetation des Guaranì-Waldes.
Hans Hostettler geniesst seit über 35 Jahren die üppige Vegetation des Guaranì-Waldes.
 Auch die Hühner gehören zum Alltag der Hostettlers.
Auch die Hühner gehören zum Alltag der Hostettlers.
 Mit seinem kleinen Flugzeug überfliegt Hans Hostettler das Naturschutzreservat, um allfällige illegale Aktivitäten zu entdecken.
Mit seinem kleinen Flugzeug überfliegt Hans Hostettler das Naturschutzreservat, um allfällige illegale Aktivitäten zu entdecken.
 Der Gemüsegarten der Familie.
Der Gemüsegarten der Familie.
 Als begnadeter Handwerker hat Hans Hostettler das Haus in Paraguay selbst renoviert und fliessend Wasser sowie Elektrizität installiert.
Als begnadeter Handwerker hat Hans Hostettler das Haus in Paraguay selbst renoviert und fliessend Wasser sowie Elektrizität installiert.
 Hans und Christine Hostettler auf einem Spaziergang im Wald.
Hans und Christine Hostettler auf einem Spaziergang im Wald.
 Bei der Pause darf der traditionelle Matetee nicht fehlen.
Bei der Pause darf der traditionelle Matetee nicht fehlen.
 Der Betrieb "Nueva Gambach" mit dem Haus der Hostettlers, den Feldern und dem Gewächshaus.
Der Betrieb "Nueva Gambach" mit dem Haus der Hostettlers, den Feldern und dem Gewächshaus.
 1984 reist Manser zum ersten Mal nach Borneo.
1984 reist Manser zum ersten Mal nach Borneo.
 Er sucht die Penan, die als Nomaden durch den Regenwald ziehen.
Er sucht die Penan, die als Nomaden durch den Regenwald ziehen.
 Bruno Manser auf einer Aufnahme von Alberto Venzago aus dem Jahre 1986.
Bruno Manser auf einer Aufnahme von Alberto Venzago aus dem Jahre 1986.
 Ebenfalls eine Aufnahme aus dem Jahre 1986, die Venzago im Rahmen eines GEO-Berichts aufgenommen hatte.
Ebenfalls eine Aufnahme aus dem Jahre 1986, die Venzago im Rahmen eines GEO-Berichts aufgenommen hatte.
 Die Zerstörung des Regenwaldes ist enorm.
Die Zerstörung des Regenwaldes ist enorm.
 März 1993 in Bern: Bundesrätin Ruth Dreifuss und Bruno Manser stricken Pullover für den Bundesrat.
März 1993 in Bern: Bundesrätin Ruth Dreifuss und Bruno Manser stricken Pullover für den Bundesrat.
 Bruno Manser und Martin Vosseler demonstrieren mit einem Hungerstreik in Bern 1993 für einen Importstop von Tropenholz.
Bruno Manser und Martin Vosseler demonstrieren mit einem Hungerstreik in Bern 1993 für einen Importstop von Tropenholz.
 Manser reist immer wieder zurück nach Europa, wo er sich aktiv für den Schutz des Urwaldes die Urbevölkerung Malaysias und Borneos einsetzt. (Keystone)
Manser reist immer wieder zurück nach Europa, wo er sich aktiv für den Schutz des Urwaldes die Urbevölkerung Malaysias und Borneos einsetzt. (Keystone)
 Auch die Penan wehren sich und bilden Blockaden im Gebiet des Oberen Baram in Sarawak, Malaysia, nahe der Gemeinde Long Ajeng.
Auch die Penan wehren sich und bilden Blockaden im Gebiet des Oberen Baram in Sarawak, Malaysia, nahe der Gemeinde Long Ajeng.
 Bruno Manser lebt als Fischer und Jäger - wie die Penan.
Bruno Manser lebt als Fischer und Jäger - wie die Penan.
 Eine Penan-Frau füttert einen Nashornvogel, auf Penan "Metui".
Eine Penan-Frau füttert einen Nashornvogel, auf Penan "Metui".
 Ara Potong, der verstorbene Häuptling von Ba Pengaran Kelian.
Ara Potong, der verstorbene Häuptling von Ba Pengaran Kelian.
 Bruno Manser mit Penan-Häuptling Along Sega.
Bruno Manser mit Penan-Häuptling Along Sega.
 Peng Meggut aus der Limbang-Region lebt heute noch als Nomade.
Peng Meggut aus der Limbang-Region lebt heute noch als Nomade.
 Bruno Manser in Sarawak, im Mai 2000, kurz vor seinem Verschwinden.
Bruno Manser in Sarawak, im Mai 2000, kurz vor seinem Verschwinden.
 Die Abenddämmerung legt sich über den Regenwald.
Die Abenddämmerung legt sich über den Regenwald.
 Das Vertrauen der Morani-Massai-Krieger zu gewinnen, ist wichtig für den Zugang zur Gemeinschaft.
Das Vertrauen der Morani-Massai-Krieger zu gewinnen, ist wichtig für den Zugang zur Gemeinschaft.
 Diskussion über Taschendesign im neuen Leder-Workshop in Mkuru.
Diskussion über Taschendesign im neuen Leder-Workshop in Mkuru.
 Es braucht scharfe Augen und flinke Finger, um den komplizierten Massai-Schmuck herzustellen.
Es braucht scharfe Augen und flinke Finger, um den komplizierten Massai-Schmuck herzustellen.
 Gabriel ist einer der wenigen männlichen Experten im Unternehmen.
Gabriel ist einer der wenigen männlichen Experten im Unternehmen.
 In der Boma, der Gemeinschaftshütte der Massai, trifft Marina ihr Team.
In der Boma, der Gemeinschaftshütte der Massai, trifft Marina ihr Team.
 Internationale Bestellungen zu erfüllen, erfordert eine genaue Planung der Produktion.
Internationale Bestellungen zu erfüllen, erfordert eine genaue Planung der Produktion.
 Es wird sich zeigen, ob die nächste Generation im Unternehmen arbeiten will, oder in die Städte zieht.
Es wird sich zeigen, ob die nächste Generation im Unternehmen arbeiten will, oder in die Städte zieht.
 Eine Massai-Frau in Mkuru zu treffen, bringt eine 50 km lange Fahrt über unebene Strassen mit sich.
Eine Massai-Frau in Mkuru zu treffen, bringt eine 50 km lange Fahrt über unebene Strassen mit sich.
 Marina bildet die neuen Mitarbeiterinnen im Verkaufsladen des Unternehmens in Arusha aus.
Marina bildet die neuen Mitarbeiterinnen im Verkaufsladen des Unternehmens in Arusha aus.
 Den Reifendruck zu überprüfen, gehört zu den vielen Dingen, die man beachten muss, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Den Reifendruck zu überprüfen, gehört zu den vielen Dingen, die man beachten muss, um böse Überraschungen zu vermeiden.
 Auf einer Farm darf man nicht vergessen, die Gatter zu schliessen.
Auf einer Farm darf man nicht vergessen, die Gatter zu schliessen.
 Piccola und Buffo sind die selbsternannten Wächter von Marinas Jurte.
Piccola und Buffo sind die selbsternannten Wächter von Marinas Jurte.
 Es ist nie zu früh, einen beruflichen Anruf entgegenzunehmen.
Es ist nie zu früh, einen beruflichen Anruf entgegenzunehmen.
 Ein Plumpsklo ist im Busch ein Luxus.
Ein Plumpsklo ist im Busch ein Luxus.
 Marina nutzt die wenige freie Zeit, um ein wenig zu lesen.
Marina nutzt die wenige freie Zeit, um ein wenig zu lesen.
 Im Workshop kommt immer wieder jemand vorbei, um Hallo zu sagen.
Im Workshop kommt immer wieder jemand vorbei, um Hallo zu sagen.
 Jeden Morgen kontrolliert Marina, ob mit ihrem Pferd Pink Fizz alles in Ordnung ist.
Jeden Morgen kontrolliert Marina, ob mit ihrem Pferd Pink Fizz alles in Ordnung ist.
 Lange Abendspaziergänge mit ihren Hunden sind Marinas Lieblingsbeschäftigung.
Lange Abendspaziergänge mit ihren Hunden sind Marinas Lieblingsbeschäftigung.